Bis zum Kriegsende in Brenig
Für Brenig entschieden wir uns, als wir dort angekommen waren
Am späten Nachmittag des 14. September 1944 gelangten wir in den Ort Brenig. Er liegt am östlichen Rand der Ville, dem sogenannten Vorgebirge. Bis zur Rheinbrücke in Bonn waren es von hier aus noch etwas mehr als zehn Kilometer. So beschlossen wir zunächst einmal, hier zu übernachten. Wir waren an dem Nachmittag die einzigen Flüchtlinge, die durchs Dorf zogen. Wir, die wir unsere wichtigsten Habseligkeiten auf unseren einfachen Fahrmöglichkeiten verladen und mit Birkenzweigen getarnt hatten, wurden nun von jedem, der uns in Brenig begegneten, regelrecht begafft. Jedenfalls kamen wir uns so vor. Auch die Unterbringung im Ort gestaltete sich zunächst schwierig. Keiner wollte so recht Flüchtlinge aufnehmen, denn unsere Gruppe bestand ja zumindest aus sieben erwachsenen Personen.
Die Quartiersuche lag in den Händen
meiner älteren Geschwister. Bis sich dann endlich eine
einfache biedere Frau fand. Es war Frau Wt., die uns aufnahm. Sie
selbst hatte sechs Kinder im Alter von ca. 6 bis 16 Jahren und
bewohnte in der Vinkelgasse ein kleines Häuschen, wie es
auch heute noch typisch in alten Dorflagen des Vorgebirges zu
finden ist. Sie musste zusehen, wie sie hier alleine zurecht kam,
denn ihr Mann befand sich als Soldat im Krieg.
Dann stellte
sich heraus, dass uns Frau Wt. auch noch an ein weiteres Haus
vermitteln konnte. Der Eigentümer des Hauses hieß
Josef Wz., sein Bruder war der Ortsvorstehen und sein einziger
Sohn war im Krieg. Diese Leute hatten noch zwei Zimmer mit Betten
frei. In einem der Zimmer stand zudem auch noch ein schöner
Herd. Außerdem war das Haus über einen Pfad, bzw. über
ein „Päddchen“, wie man in Brenig sagte,
unmittelbar hinter dem Grundstück der Familie Wt. zu
erreichen. In jener schwierigen Zeit sahen so schon ideale
Umstände aus und wir waren froh, dass wir so über zwei
Häuser verteilt unterkommen konnten.
Uns allen gefiel das sehr und wir waren zudem immer noch auf der linken Rheinseite. Mein Vater war von diesen Verhältnissen so sehr beflügelt, dass er unsere Wirtsleute fragte, ob wir nicht überhaupt auch längere Zeit bleiben durften. Die Wirtsleute zeigten ein Herz und nahmen uns tatsächlich „endgültig“ auf. Wir waren glücklich: Die Flucht hörte einstweilen auf, wir waren gut untergebracht und die Front war noch weit weg. Hier war es ruhig, wie es uns schien und wir waren die einzigen Flüchtlinge im Ort.
Da meine Schwester Klara genügend
Lebensmittelkarten in Walheim gehortet hatte, meldeten wir uns
zunächst nicht polizeilich an. Vater wollte die Anmeldung so
weit wie möglich vor sich herschieben. Außerdem war
das Vorgebirge ein Fleckchen Erde, dass von Lebensmitteln selbst
im Krieg verhältnismäßig reich gesegnet war.
Bekanntlich finden sich an diesem Ville-Hang sehr fruchtbarer
Lös-Boden und ein verhältnismäßig günstiges
Klima. Die meisten Breniger waren Selbstversorger und viele
hatten „Säue“ im Stall, weshalb es auch an
„Fettigem“ nicht mangelte. Zu essen hatten wir also
genug hier und auch sonst merkte man im Frühherbst 1944 in
Brenig noch nicht so sehr viel vom Krieg.
Vater wollte sich
auch deshalb nicht polizeilich anmelden, weil er nach fünf
Jahren Krieg Gefahr lief, trotz seines Alters von 58 Jahren auch
noch zum Dienst an der Waffe eingezogen zu werden. In seinem
Heimatort Walheim war sein Schreinereibetrieb als kriegswichtig
bewertet worden und er selbst als unabkömmlich für den
Betrieb anerkannt. Diese Begründung war ihm mit seiner
Flucht jedoch abhanden gekommen. So verging die Zeit. Irgendwann
hatte sich mein Vater dann aber doch polizeilich gemeldet. Denn
bis dahin war die Angst mehr und mehr gewachsen, entdeckt zu
werden. Die Nazi-Behörden hätten anschließend
ermitteln können, wie lange wir schon tatsächlich in
Brenig waren und das hätte uns neue Probleme gebracht.
Die
Anmeldung verlief dann auch problemlos für uns. Wegen des
wachsenden Flüchtlingsaufkommens im Vorgebirge gab es bei
den Ämtern vermutlich viel zu tun und ein kleines
Durcheinander. Jedenfalls erhielt mein Vater anschließend
keinen Einberufungsbefehl zur Wehrmacht.

Brenig
um 1938. In der Bildmitte das Haus Wt., wo die Familie Krott
zunächst Aufnahme fand und auch ein Teil der Familie die
Zeit in Brenig verbringen konnte
Das
ehemalige Haus Wz. im Februar 2014 auf dem heutige Bergkreuzweg.
Peter Krott selbst und seine Eltern wohnten bis zum Kriegsende
darin
Das
heutige Haus mit etwas mehr Umgebung

Luftansicht
von Brenig um 1935. Die Kirche trägt über der Vierung
noch ein kleinen Türmchen, den sogenannten Reiter.
Grüner
Pfeil rechts: Anstelle des heutigen Pfarrhauses ist noch das alte
Pfarrhaus zu sehen, das gegen Kriegsende von einer Bombe zerstört
wurde.
Der grüne Pfeil links weist auf die ehemalige
„Küsterei“. Diese wurde von derselben Bombe
zerstört, wie auch das Pfarrhaus. Ende der 1950er Jahre
wurde an seiner Stelle das erste Jugendheim erbaut.
Der rote
Pfeil rechts zeigt das Haus Wt. in der Vinkelgasse und der Pfeil
in der Mitte das Haus Wz.. Der Pfeil links oben zeigt auf die
Schreinerei H. in der Rücksgasse
Flüchtlingsjobs
In den ersten Tagen in Brenig hatten wir uns alle das Dorf gründlich angesehen. Es war ein typisches Vorgebirgsdorf: Fast alle Einwohner lebten vom Gemüsebau, die meisten hauptberuflich und ebenfalls sehr viele im Nebenerwerb. Es gab zwei Bäcker, einen Metzger und ein Kolonialwarengeschäft. Meine älteren Schwestern hatten sich noch im Herbst 1944 bei verschiedenen Bauern als Erntehelfer betätigt.
In Brenig gab es aber auch einen selbständigen Schreinermeister in der Rücksgasse. Im Oktober 1944 machte sich mein Vater auf den Weg zu im, um einmal vorzufühlen, ob er nicht bei ihm Arbeit finden könne. Der Schreiner mit Namen H. hatte wahrscheinlich noch Aufträge in der Schublade und stellte deshalb meinen Vater ein. Doch damit nicht genug. Mein Vater sprach seinem neuen Arbeitgeber gegenüber auch von mir und wies darauf hin, dass ich „ja Schreiner-Lehrling“ sei. Beide kamen dann überein, dass auch ich beim Schreiner H. arbeiten könne, allerdings ohne Lohnzahlung, nur für das mittägliche warme Essen. So trat ich also zusammen mit meinem Vater die Arbeit bei der Schreinerei H. an.
Die Schreinerei des Meisters H. nahm sich
deutlich kleiner aus, als die meines Vaters in Walheim. H.
verfügte über einige einfache Holzbearbeitungsmaschinen
und obwohl diese nur relativ klein waren, stand im Werkstattraum
wegen seiner kleinen Maße auch alles sehr eng beisammen.
Meine Hobelbank war aus Platzgründen fest an die Außenwand
angestellt. Sie war damit nicht zu „umgehen“, was bei
bestimmten Fertigungsmaßnahmen aber erforderlich gewesen
wäre. Das war in Brenig aber insofern kein Problem, da ich
nur an Kleinigkeiten arbeitete. Was ich da im Einzelnen alles
produziert hatte, weiß ich heute nicht mehr. Neben meiner
fachlichen Arbeit war ich allerdings die Hälfte meiner
Arbeitszeit mit „Kalfaktorarbeiten“ beschäftigt:
So musste ich beispielsweise jeden Morgen auf einem nahe
gelegenen Grundstück die über Nacht vom Baum gefallenen
Pfirsiche, im Vorgebirge „Peärsche“ genannt,
auflesen. Davon wurde anschließend Obstler gebrannt. Aber
ehe ich den Heimweg antrat, hatte ich mich noch auf eine Astgabel
gesetzt und mir die größten und schönsten
Pfirsiche einverleibt.
Auch mein Vater konnte seine Arbeiten
nur unter beengten Platzverhältnissen ausführen.
Zwischen seiner Hobelbank und der nächstgelegenen Wand waren
auch nur ca. 70 cm Platz. Zudem stand die Hobelbank gegen eine
andere gelehnt. Als erstes hatte mein Vater dort mit der Arbeit
an einem Schlafzimmer aus Eichenholz begonnen. Im Krieg gab es ja
nichts zu kaufen und vermutlich resultierte dieser Auftrag von
einem Versprechen des Meisters her. Auf alle Fälle hatte
mein Vater in der beengten Werkstattecke das Werk, bestehend aus
Betten, Schrank und Kommoden, vollendet.
Mittags gab es immer ein deftiges Essen,
meistens Eintopf, der von der Frau des Hauses zubereitet wurde.
Er war durchweg lecker, immer mächtig mit Schweinefleisch
durchsetzt und deshalb nahrhaft. Ein Schnaps nach dem Essen war
für den Meister obligatorisch. Danach fiel er in seinen
Mittagsschlaf. Mein Vater ging jeden Mittag zum Essen nach Hause
ins Haus Wz. auf der Kumme (heute Bergkreuzweg).
In der
Familie lebte auch noch eine erwachsene Tochter. Ich schätzte
sie damals auf rund 35 Jahre. Sie war nicht berufstätig und
hatte auch keinen Freund, denn die Männer waren ja alle
Soldat. Dann tauchte ab und zu ein älterer Sohn auf, der
angab, selbst Schreinermeister zu sein. Offenbar war der wegen
einer Gehbehinderung nicht Soldat geworden. Dieser Sohn war nicht
ständig im Betrieb und arbeitete nur an kleinen Möbeln.
Der Meister lieferte auch bei Sterbefällen den Sarg. Der wurde von Grund auf und vollständig in der Schreinerei gefertigt, denn H. hatte viel Eichenholz auf Lager, mehr als Fichtenholz. Wenn alles fertig war, lud er die Lade auf einen Karren und fuhr damit alleine zum Sterbehaus, wohl wissend, dass die Angehörigen ihm beim Einsargen helfen würden. Bei uns in Walheim wäre so etwas undenkbar gewesen.
Draußen im Hof hatte Schreinermeister H. eine Holzgattersäge, auch kurz „Holzgatter“ genannt, stehen. Die Technik dieser Sägeanlage mutete schon recht altertümlich an: Es war ein sogenanntes Horizontalgatter, mit dem jeweils nur ein Brett vom Stamm geschnitten werden konnte. Weil auch ich mit dieser Maschine arbeiten sollte, hatte mir Meister H. eines Tages die Funktionen und die Handhabung erklärt und so durfte ich anschließend tagelang von dicken Eichenstämmen Bohlen herunterschneiden.
Unweit des Gatters hatte sich Meister H. schon vor Jahren einen kleinen Unterstand angelegt. Als Abdeckung dienten geschnittene und ungeschnittene Eichenstämme. Als in den ersten Monaten 1945 die Front auch dem Vorgebirge näher rückte, hatte ich dort mehrmals Schutz vor den Tieffliegern, Jabos und Jagdbombern der Alliierten gesucht.
Einmal bin ich mit dem Meister zu Fuß
nach Alfter-Ort gegangen. Dort hatten wir eine kleinere Arbeit zu
verrichten, die jedoch mehr als nur zwei Hände bedurfte. Bei
diesem Gang hatte er auch einen Flachmann in der Tasche. Ab und
zu machte er Pause und genehmigte sich dann jeweils einen Schluck
daraus.
Der Schnaps, übrigens ein leckerer Obstler,
wurde im alten Stall des Hauses ausschließlich von Obst
gebrannt, und zwar insbesondere von Fallobst, das bekanntlich
schneller in den Gärprozess übergeht als frischeres vom
Baum gepflücktes Obst. Übrigens war die
Schnapsbrennerei zu Hitlers Zeiten nicht minder streng verboten
als auch heute; im Falle der Aufdeckung fielen die Strafen damals
außerordentlich hart aus. Aber die Breniger zeigten sich
nicht gegenseitig an, wurde doch in vielen Häusern schwarz
gebrannt. Jedes mal, wenn der Meister einen Schnaps-Brand
vollzogen hatte, erhielt auch mein Vater ein Püllchen von
den edlen Tropfen.
Schließlich hatte fast jedes Haus in Brenig nach meinem Empfinden mindesten zwei Schweine – in Brenig sagte man Säue – im Stall. Wenn so eine Sau geschlachtet werden sollte, war der Eigentümer des Schweins verpflichtet, dieses beim Amt anzumelden. Dabei ging es um die Rationierung der knappen Nahrungsmittel. Die Breniger schlachteten regelmäßig zwei Säue, gaben beim Amt aber immer nur eine an. Daher schwelgten sie nach meinem Empfinden im Fleisch.
Bekanntschaften hatte ich in Brenig keine
geschlossen. Insgesamt nahmen wir dort nur wenig am Dorfgeschehen
teil. Zudem waren wegen des Winterhalbjahres die Tage kurz und
wegen des Krieges gab es keine Veranstaltungen wie Tanz und
Kirmesvergnügen.
Aber sonntags besuchten wir alle die
heilige Messe. Ich ging immer in die Messe um 10:00 Uhr. Dieser
Gottesdienst war durchweg sehr gut besucht, weshalb ich mich
meistens mit den anderen im Dorf noch vorhandenen jungen Männern
bzw. größeren Jungs unter dem Kirchturm aufhielt.
Wegen der vielen Gottesdienstbesucher konnte ich von dort aus den
Pastor am Altar meistens nicht mehr sehen. Die meisten
Kirchenlieder kannte ich schon von Walheim, wenn auch einige in
einer etwas anderen Melodie gesungen wurden.
Die übrigen Familienmitglieder gingen in
unserer „breniger Zeit“ ebenfalls Beschäftigungen
nach:
Meine vier weiblichen Geschwister hatten nach meiner
Erinnerung im Herbst noch zunächst verschiedenen Bauern bei
der Ernte geholfen.
Klara, die zuhause Verkäuferin
gelernt hatte, trat später in Bornheim eine Stelle in einem
Elektroladen an.
Lisa war sozusagen der „Spieß“
der Familie. Sie kümmerte sich um alles Schriftliche, wie
Anmeldungen, Anträge, Entgegennahme von sog. Bezugsscheinen,
Amtsgänge usw.. Ich meine mich zu erinnern, dass sie später
sogar eine Stelle bei der Gemeindeverwaltung von Bornheim
bekommen hatte.
Lina und Barbara – wir nannten sie immer
Bäbi - halfen weiter bei Bauern aus, unterstützten aber
auch die Mutter bei den Hausarbeiten.
Die
Rücksgasse im Februar 2014. Das rote Auto steht vor einer
Schreinerei,
die mit der von Peter Krott benannten nicht
verwechselt werden darf
In
diesem Gehöft war die bis in den 1950er Jahren die
Schreinerei H. untergebracht. Die Platzverhältnisse waren
dort sehr begrenzt. Die heute in der Rücksgasse zu findende
Schreinerei hat mit der von Peter Krott benannten nichts zu tun
Das
ehemalige Schreinereihaus von der Talseite aus betrachtet. An der
Hausseite, wo jetzt das Efeu rankt führte das
„Rückspäddchen“ ein kleiner Fußweg
zur Kumme und zu Ortskern von Brenig. Wer dort in den 1970er
Jahren entlang ging konnte hinter dem Haus noch das Holzgatter
finden. Heute erinnert nichts mehr an den früheren
Schreinereibetrieb
Die
Rücksgasse aus der Blickrichtung des heutigen
Bergkreuzweges. Der linke Pfeil weist auf die Schreinerei H., der
mittlere und der rechte Pfeil weisen auf das „Rückspäddchen“
Blick
vom heutigen Bergkreuzweg auf Brenig. Der Verlauf des
Bergkeuzweges entspicht hier noch dem Verlauf der früheren
Kumme. In der Kurve hinter dem jungen Mann traf das
„Rückspäddchen“ auf die Kumme. Etwa in der
Bildmitte das ehemalige Haus Wz.
Mit den
Wt.-Töchtern nach Bonn
Einmal fuhr Peter Krott
zusammen mit den Töchtern der Familie Wt. nach Bonn. Dazu
ging man zu Fuß bis nach Bornheim und fuhr von dort aus mit
der Vorgebirgsbahn weiter. Die Wt. Töchter trafen in
Bornheim befreundete Mädchen, die auch nach Bonn wollten.Mit
denen setzten sich die Wt.-Töchter zusammen in ein offenes
Abteil der Vorgebirgsbahn. Weil für Peter Krott deshalb kein
Platz mehr in diesem Abteil war, nahm der woanders Platz. Obwohl
der Abstand etwas größer war, bekam er mit, wie die
Mädchen sich über ihn unterhielten: Wer das denn sei?
Worauf eine der Wt. Töchter unter vorgehaltener Hand er
klärte, dass das „doch ein Flüchtling“ sei.
Darauf musterten ihn die übrigen Mädchen auf über
die Distanz hinweg sehr gründlich und meinten dann zu den
Wt.s Töchtern: „Dat kann kene Flüchtling senn,
der ist zu jung!“ Die Mädchen hatten nicht damit
gerechnet, dass Krott diese Unterhaltung noch mithören
konnte. Krott muss jedenfalls bis heute noch über dieses
Gespräch schmunzeln.
Fliegerbombe auf der Kumme und Tod des Pastors
An einem Mittag im November/Dezember stand ich vor der Schreinerei H. in der Rückgasse und beobachtete das Turnen alliierter Flieger am Himmel, als plötzlich und unerwartet eine Fliegerbombe auf der Kumme einschlug, und zwar aus meiner Perspektive genau dort, wo das Haus Wz. stand, in dem wir wohnten. Es gab eine gewaltige Rauchwolke. Ein Nachbar der Familie H., der das Geschehen ebenfalls beobachtet hatte rief: „Da liegt sie auf der Kumme bei Wz.!“. Mir zuckte es durch den ganzen Körper, hielten sich doch meine Eltern zum Mittagessen gerade dort auf. Ich war in größter Sorge und rannte deshalb so schnell ich konnte über das „Rücks-Päddchen“ zum Haus Wz. Indem ich näher kam, erkannte ich dann jedoch zu meiner großen Erleichterung, dass das Haus noch stand und als ich dort ankam, sah ich, dass noch nicht einmal eine Fensterscheibe kaputt gegangen war. Die Bombe war indessen unmittelbar im Garten hinter dem Haus im weichen Sandboden eingeschlagen und hatte einen mächtigen Krater hinterlassen bei dem der unter dem Mutterboden befindliche weiße Sand hochgeflogen und in der Umgebung verstreut war. Die Energie der Bombe hatte sich wegen des weichen Bodens auf den Bombentrichter selbst beschränkt.

Theodor
Breitbach im Herbst 1944
Anfang Januar 1945 fiel an einem Abend eine Fliegerbombe aufs Pfarrhaus, das dabei weitestgehend zerstört wurde. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass ein Bombensplitter den Pfarrverwalter Breitbach getroffen hatte, während der gerade in seinem Wohnzimmer saß. Diese Verletzung habe ihn getötet.

Der
Innenraum der Breniger Kirche St. Evergislus, wie er sich bis
Anfang der 1950er Jahre zeigte. Glücklicherweise hielten
sich die Kriegsschäden der Kirche in Grenzen. Die prächtigen
Leuchter ließ der damalige Pfarrer Stahl in den 1950er
Jahren entfernen
Vor der Front kamen die Tiefflieger
Seit Sommer 1944 rückte von Westen kommend die Front Deutschland immer näher. Im Herbst 1944 hatte sie die Grenze des Deutschen Reiches erreicht und blieb auf der Linie Hürtgen, Zweifall, Mausbach stehen. Dieses nicht zuletzt deshalb, weil die Alliierten zunächst Aachen als erste deutsche Großstadt einnehmen wollten. Krotts Heimatort Walheim war schließlich schon am 13.09.1944 kampflos von den Amerikanern eingenommen worden. Im Bereich des Hürtgenwaldes entwickelte sich indessen von Ende Oktober bis Anfang 1945 erbitterte Kämpfe, die auf beiden Seiten einen hohen Blutzoll forderten, und zwar von den Amerikanern mehr noch als von den Deutschen. Über die Kämpfe im Hürtgenwald gibt es inzwischen sehr viele gutes und beeindruckendes Informationsmaterial, auf das an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird. In dieser Zeit wurden die bis dahin blühenden Städte Düren und Jülich wie auch zahlreiche Dörfer der Region durch Bombenangriffe aus der Luft fast dem Erdboden gleich gemacht bzw. total zerstört.
Eine deutsche Luftabwehr durch die Luftwaffe existierte nicht mehr bzw. war der alliierten Übermacht in keinster Weise mehr gewachsen. Relativ gefahrlos konnten alliierte Flugzeuge über Deutschland agieren. Zur amerikanischen Taktik gehörte es damals wie heute, dass vor dem Einsatz der Bodentruppen die Airforce die Vorarbeiten leistet. Dazu Peter Krott in seinen Erinnerungen:
Das Gebiet hinter der Front, also auch wir im Vorgebirge, sah sich ab Jahresanfang 1945 tagtäglich mit der gegnerischen Luftwaffe konfrontiert. Die Jabos, Jagdbomber der Alliierten, waren morgens von Sonnenaufgang bis abends zum Sonnenuntergang unsere Gäste. Sie bildeten immer ein Pärchen und schossen auf alles, was sich bewegte. Sobald sie ihren Sprit verbraucht hatten, kam schon die Ablösung. Sie konnten es sich leisten, ziemlich tief zu fliegen, um alles im Sichtflug zu kontrollieren. Dabei konnte man umgekehrt oft vom Boden aus den Piloten in seiner Maschinen erkennen oder zumindest sitzen sehen. Es war unmöglich, sich zu Fuß fortzubewegen. Das hätte womöglich das Ende bedeutet. Häuser und sonstige zivile Ziele griffen die Tiefflieger nicht grundlos an. Interessant waren für sie militärische Ziele bzw. alles was für die militärische Infrastruktur bedeutsam sein konnte: Das waren Bahneinrichtungen, Fabriken, Wasser- und Energieversorgung. Dennoch waren alle, die sich draußen auf freien Flächen und auf Straßen bewegten besonders gefährdet und wurden auch oft beschossen. Erst wenn die Tiefflieger sich wieder verzogen hatten, konnte man sich nach draußen trauen und seinen Gang fortsetzen. Bis dahin versteckte man sich unter einen geeigneten Baum oder in einer Haustürnische.
Der Luftangriff auf Heimerzheim, vom Samstag, dem 03.03.1945, also nur wenige Tage bevor die Bodentruppen zunächst Heimerzheim und anschließend das Vorgebirge vereinnahmten, hatten im Nachhinein die Region bestürzt. Die Detonationen des konzentrierten Angriffs waren weit zu hören und versetzten auch die Bewohner der umliegenden Ortschaften in Angst und Schrecken: Kommt dieses Übel auch bald über uns? Peter Krott:
„Ich war zu der Zeit in der kleinen Schreinerei H. und das ganze Häuschen hatte die ganze Zeit über gebebt. … Natürlich bin ich aus Angst im Schweinsgalopp in den Unterstand im Hof geflogen. Im Nachhinein können wir froh darüber sein, dass wir damals im September 1944 nicht in Heimerzheim hängen geblieben sind. Vater fuhr immer vorwärts und so sind wir dann ja in Brenig gelandet. Brenig war für mich ein anheimelnder Ort.
Kurz vor der Einnahme Brenigs hatte noch ein großer Luftangriff der Alliierten auf Köln stattgefunden. Es war ein klarer Frühlingstag, als bei hellichtem Sonnenschein die schweren Bomber südlich von Brenig rheinwärts in zwei Phasen von je über 400 Flugzeugen flogen. Über dem Rhein machten sie einen Linksbogen und flogen dann dem Rhein folgend nach Köln. Wir schauten auf dieses Spektakel mit Schrecken und dachten mit Bedauern an die Menschen, die zu der Zeit noch in Köln waren.

Amerikanischer
Jäger „Thunderbol“
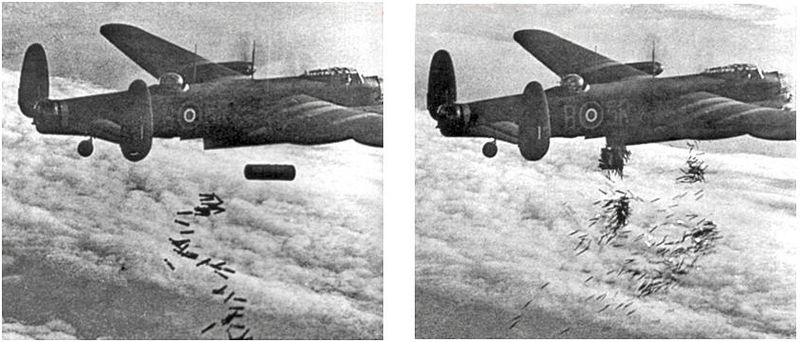
Lancester-Bomber
beim Abwurf von Luftminen und Bomben

Amerikanischer
B17 Bomber, wie sie im Zweiten Weltkrieg regelmäßig
eingesetzt wurden. Foto:
Wikipedia
Einen Bombenangriff erlebte Peter Krott auch, als er zusammen mit dem Meister H. einen Reparaturauftrag in Bornheim erledigen musste. Zuvor hatten Tiefflieger in der Nähe des bornheimer Friedhofs einen mit Munition beladenen Reichsbahnzug beschossen und getroffen. Die nach und nach explodierende Munition richtete in Bornheim viele Schäden vornehmlich an den Fenstern der Häuser an, die notrepariert werden mussten. Während der Fensterreparatur setzte der Bombenangriff ein und die Kundin wies uns den Weg zu dem Keller, den man zum „Luftschutz“ mit Zusatzstützen stabilisiert hatte. „Der ganze Keller hatte gebebt und ich rechnete schon damit, nicht mehr lebend aus dem Keller herauszukommen“, erinnert sich Krott heute mit Schrecken an diese Erlebnis.
Ein Gefühl von Freiheit
Am Dienstag, dem 06.03.1945 wurde Brenig von den Amerikanern eingenommen. In der Nacht zuvor war der Ort noch von der Artillerie beschossen worden. Hier und dort stießen die Amerikaner auf einzelnen Widerstand, so im von der Rückgasse nicht weit gelegenen Schornsberg und im Garten hinter der Metzgerei Haus Breite Str. 10. Die lange Mauer zur Abgrenzung des Geländes zu Haus Rankenberg trennte ebenfalls eine zeitlang die sich noch wehrenden Deutschen von der Übermacht der Amerikaner. Krott weiter:
Der Einnahme Brenigs war nachts ein Artilleriefeuer vorausgegangen, wobei die meisten Granaten auf der Kumme einschlugen (heute Bergkreuzweg), die nicht bebaut war. Die Kumme war morgens voller Einschläge, Trichter an Trichter.
Unser Vermieter Josef Wz. hatte am Tag, bevor die Amerikaner kamen, zusammen mit seinem Bruder Wilhelm die Flucht „über den Rhein“ in Richtung Westerwald angetreten. Außer uns wohnte im Hause Wz. noch eine Familie S., zu der auch ein kleiner Junge mit Namen Lorenz gehörte. Vom amerikanischen Radiosender, den wir in Brenig abgehört hatten, erfuhren wir, dass wir aus den Fenstern weiße Fahnen hängen sollten, als Zeichen der Ergebung. Wir hatten natürlich auch so eine Fahne herausgehängt. Am anderen Tag nach der Einnahme war ich im Ort und alle Häuser waren mit weißen Fahnen in allen Schattierungen behangen. Es sah richtig freundlich aus.
An besagtem Morgen sah ich die Amerikaner mit
Gewehr im Anschlag durch das Küchenfenster auf unser Haus
zukommen. Dann kamen noch mehrere. Ich informierte die Übrigen
im Haus und wir sind dann zaghaft vor die Tür getreten. In
unserem Haus lagen auch drei deutsche Soldaten, die mit erhobenen
Händen hervortraten. Sie wurden sofort abgeführt.
Vater und ich mussten vor einem Amerikaner die Füße
hochheben und die Schuhe zeigen. Nachher hatten wir erfahren,
dass deutsche Soldaten sich zivil angezogen hatten, dabei aber
vergaßen, die Schuhe zu wechseln. So konnten die Amerikaner
sie an Ihren Militärschuhen oder Stiefeln erkennen. Wenn
einer von uns zufälligerweise solche Militärdinger
angehabt hätte, wären wir zunächst auch in
Gefangenschaft geraten.
Nach dem Durchzug der eigentlichen Front blieb ein Teil Amerikaner als Nachhut in Brenig zurück. Die spazierten freiweg durch den Ort und nachts liefen ihre stromerzeugenden Generatoren bei hellstem Licht, denn sie brauchten keine deutschen Flieger zu fürchten. Spätestens ab dieser Zeit stellte sich bei uns das Gefühl von Freiheit und Erlösung vom Krieg ein. Es war ein schönes Gefühl, das wir bis dahin schon fast nicht mehr kannten, aber wir waren noch nicht zu Hause.
Die
Kumme selbst (heute Bergkreuzweg) und die Fläche im Bild
rechts davon, war voll mit Granateneinschlägen vom
nächtlichen Artilleriefeuer. Zum Glück waren diese
nicht in die Wohnbebauung eingeschlagen. Die Breniger hatten sich
zu der Zeit durchweg in zum Bombenschutz verstärkte Keller
zurückgezogen
Blick
aus der Vinkelgasse auf die Kirche. Brenig blieb von
Kriegsschäden bis auf das Pfarrhaus und die ehemalige
Küsterei weitgehend verschont. Die im Bild zu sehende
heutige Bausubstanz entspricht zu einem großen Teil der des
Jahres 1945. Rechts das Haus Wt. mit einigen Veränderungen.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht mit dem
hellbraunen Tor der Bauernhof, der ehemals Bernhard P. gehörte.
Dieser erzählte schon Wochen bevor die Alliierten kamen,
Freunden in Brenig: „Mein Hof könnte in Frage kommen“.
Damit meinte er, dass sein Hof von den Alliierten wegen seiner
Größe und Lage requiriert werden könnte.
Letztendlich war dem auch wirklich so. Die Amerikaner richteten
dort gar vorübergehend eine Kommandozentrale ein. Krott:
„Die spazierten freiweg
durch den Ort und nachts liefen ihre stromerzeugenden Generatoren
bei hellstem Licht, denn sie brauchten keine deutschen Flieger zu
fürchten“